| 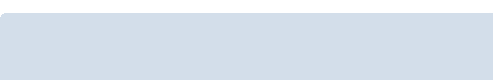 | 
 |  |  |  | 
| | Vater, Mutter, Kind |  |  |  | |  |  |  | Von Johannes Röser |  |  |  | Neue medizinische Erkenntnisse wecken schwerste Bedenken gegen allzu frühe und allzu lange außerfamiliäre Betreuung von Kleinstkindern. Die Krippenplatz-Debatte erscheint hier in einem neuen Licht.
Lehrerinnen und Lehrer beobachten es seit langem: Verhaltensstörungen, Disziplinlosigkeit, Respektlosigkeit, Konzentrationsmangel und Missachtung selbst der einfachsten Umgangsformen haben in den letzten zwei Jahrzehnten unter Kindern und Jugendlichen massiv zugenommen. Dazu kommen erhebliche Leistungseinbrüche. Mancher Lernstoff, der früher Standard war, ist in vielen Klassen heutzutage gar nicht mehr zu vermitteln. Man schraubt daher die Anforderungen, das Niveau runter und benotet die schlechteren Leistungen besser, um überhaupt noch einen gewissen Durchschnitt zu wahren.
Was Fachleuten längst bekannt ist, wurde durch eine Allensbach-Studie soeben bestätigt. Jeder zweite Lehrer sagt, dass Unterrichten schwieriger geworden ist. Man müsse immer mehr Aufgaben des Elternhauses übernehmen. Insbesondere zu den Eltern von Problemkindern sind die Kontakte - sofern sie überhaupt zustandekommen - kompliziert. Einerseits verlangen die Eltern, die Lehrer sollten härter durchgreifen, andererseits klagen sie mit Rechtsanwälten, wenn sie ihren Nachwuchs in der Schule als ungerecht behandelt empfinden. Die „Frankfurter Allgemeine" meint: „Offenbar gibt es immer mehr Eltern, die sich ausschließlich als Lobbyisten ihres Kindes verstehen und jede Kritik an ihrem Verhalten als narzisstische Kränkung empfinden."
Lehrer sind jedoch keine Ersatzeltern. Umgekehrt sind und bleiben die Eltern die ersten Lehrer ihrer Kinder - von Anfang an, ein ganzes Leben lang, auch in der Art, wie Mann und Frau miteinander umgehen, wie sie Probleme meistern, wie sie schließlich altern, leiden und sterben. Manche Teile der Gesellschaft scheinen allmählich allerdings zu spüren, dass in den Erziehungsfragen Grundlegendes schiefläuft.
Verschiedene Faktoren sind offenkundig. Zum einen werden Kinder auffällig, wenn sich Vater und Mutter trennen. Die emporgeschnellten Scheidungen sind eben nicht belanglos für die seelische Gesundheit sowie die sogenannte kognitive Kompetenz, also die Lern- und Denkfähigkeit der betroffenen Kinder und Jugendlichen.
Wie erwachsen sind Erwachsene?
Ein bisher noch wenig beachtetes Problemfeld ist die Infantilisierung der Erwachsenenwelt, die sich immer kindischer benimmt, statt selber vorbildhaft erwachsen Kinder ins Erwachsensein zu führen. Man kann das infantil-pubertäre Getue, Gespiele und Gekreische erwachsener Leute überall beobachten, von der Mode über den Sport bis zum Star-Rummel. Soeben erst wurde es uns wieder vorgeführt, als eine zwar spannende, spielerisch jedoch mittelmäßige, bloß durch Elfmeterschießen entschiedene Halbfinal-Begegnung des FC Bayern bei Real Madrid aus kommerziellen Gründen sogar von Reportern, die kritisch zu sein hätten, zur Partie des Jahrhunderts hochgejubelt wurde. Die absurde Inszenierung des Spielerempfangs mit enthusiastisch grölenden und die Stars anhimmelnden „Erwachsenen" wurde von den Fernsehnachrichten minutenlang als erste Meldung zelebriert. Sind wir wirklich schon derart realitätsblind geworden, dass man uns alles verkaufen und selbst Niederlagen wie einen bloß dritten Platz bei einer WM zum „Sommermärchen" stilisieren kann? Nicht einmal Vizeweltmeister!
Neben den pubertären Albernheiten einer infantilisierten Erwachsenenwelt wirken sich weitere Trends verhängnisvoll auf die Entwicklung von Kindern aus. Besonders dramatisch ist, dass Eltern in der heute üblichen Arbeits- und Konsumkultur, die hohe Mobilität und Flexibilität einfordert, immer weniger Zeit haben oder sich immer weniger Zeit nehmen, um sich intensiv um ihren Nachwuchs zu kümmern. Man spricht schon von Wohlstandsverwahrlosung: Materiell haben die Kinder alles, für ihre Sinnbildung geistig, spirituell, religiös jedoch haben sie immer weniger, oft nichts. Weil Vater und Mutter meistens beide berufstätig sind und weil allein schon aus finanziellen Gründen Doppelverdiener notwendig sind, um als Familie über die Runden zu kommen, leiden darunter zuerst die, die eine dauerhafte Bezugsperson brauchen.
Hinzu kommt die allgemeine Emanzipationsdynamik, welche die Leistung von Frauen - und Müttern - allenfalls dann anerkennt, wenn sie erwerbstätig sind. Erziehungsleistungen werden weder durch einen auch nur annähernd angemessenen Familienlastenausgleich gerecht belohnt noch imagemäßig honoriert. Kinder kosten, und sie selber zahlen am Ende die Zeche, spätestens wenn die gigantisch aufgeblähte Staatsverschuldung unsere Kinder frisst.
Die Hinweise auf familiär, gesellschaftlich und politisch mitverursachte Entwicklungsstörungen des Nachwuchses verdichten sich. Die faktische „Kulturrevolution" des letzten halben Jahrhunderts geht an den heute Heranwachsenden nicht spurlos vorbei, wie jetzt auch Kinder- und Jugendärzte diagnostizieren. Doch der Mainstream, der unverdrossen propagandistisch auf Kindertagesstätten, Tagesmütter und möglichst umfassende Kleinstkinderbetreuung außerhalb der Familie setzt, lässt sich selbst von den durch die Hirnforschung untermauerten Fakten nicht beeindrucken. Dabei weisen inzwischen sehr viele Untersuchungen darauf hin, dass der elterliche Entzug für die Allerkleinsten bis zu drei Jahren besonders hohe psychische, psychosomatische, somatische und soziale Risiken birgt.
Ärztlicher Alarmruf
Der Mediziner, Neurologe und Leitende Arzt des Sozialpädiatrischen Zentrums Bielefeld-Bethel Rainer Böhm hat in einem aufschlussreichen Aufsatz der FAZ (4. April) die Erkenntnisse veranschaulicht: „Die dunkle Seite der Kindheit" - anscheinend jedoch mit eher magerer öffentlicher Resonanz. Auch Talkshows, die sonst jede Banalität aufgreifen und zigmal durch die Redemühle drehen, tabuisieren die politisch unkorrekte medizinische Seite des Themas. Der Befund, der mittlerweile durch Langzeitbeobachtungen vom ersten Lebensmonat bis ins Jugendalter hinein untermauert wird, ist allerdings erschreckend: Denn bei sehr vielen der schon früh außerfamiliär betreuten Kinder kann man „einen deutlichen Rückgang sozioemotionaler Kompetenz" feststellen. Und das trifft international zu. So ist in den Vereinigten Staaten nachgewiesen worden, dass im Vergleich zu den siebziger Jahren die Kinder anderthalb Jahrzehnte später im Durchschnitt deutlich „verschlossener, mürrischer, unglücklicher, ängstlicher, depressiver, aufbrausender, unkonzentrierter, fahriger, aggressiver" waren. Zudem wurden sie häufiger straffällig.
Im letzten Jahr ist in Deutschland bei einem Kinderärzte-Kongress die aufsehenerregende Großstudie des renommierten amerikanischen Nationalen Instituts für Kindergesundheit und Entwicklung (National Institute of Child Health and Development) ausführlich vorgestellt worden, die über lange Zeiträume hinweg das Verhalten und die Entwicklung von mehr als 1300 Kindern repräsentativ und detailliert gemessen und zusätzlich weitere 300 wissenschaftliche Publikationen ausgewertet hat. Demnach steht positiv fest, dass eine gute Eltern-Kind-Bindung selbst durch außerfamiliäre Störungen oder durch außerfamiliäre Betreuung nicht grundsätzlich negativ beeinflusst wird. Aber umgekehrt ist leider klar und unzweifelhaft, dass - so Böhm - sehr frühe und umfangreiche Betreuung von zweifelhafter Qualität mit erheblichen Risiken für das Bindungsmuster zwischen Mutter und Kind einhergeht. Damit erhöht sich auch das Risiko, später an einer psychischen Störung zu erkranken.
Stress wie bei einem Manager
Eine hohe Betreuungsqualität, wie sie überall gefordert wird, verbessert wiederum gewisse kognitive Leistungen, also die Lernfähigkeit, das Denken und Wissen im Vorschulalter. Dieser Unterschied und „Vorsprung" hält sich zum Teil noch bis zur Sekundarstufe, wird aber allmählich ausgeglichen, schmilzt dahin. Zutiefst beunruhigend ist hingegen, dass sich die Krippenbetreuung „unabhängig von sämtlichen anderen Messfaktoren negativ auf die sozioemotionale Kompetenz der Kinder" auswirkt. Das heißt: Je mehr Zeit die Kinder in einer Betreuungseinrichtung verbringen, desto stärker zeigen sie auch später ein sozial gestörtes Verhalten: „Streiten, Kämpfen, Sachbeschädigungen, Prahlen, Lügen, Schikanieren, Gemeinheiten begehen, Grausamkeit, Ungehorsam oder häufiges Schreien". Unter den ganztags betreuten Kindern zeigt ein Viertel bereits im Alter von vier Jahren ein Problemverhalten, das laut Böhm bereits im Grunde als „klinisch" relevant zu betrachten ist und entsprechend als Krankheit behandelt werden müsste. Die Konflikte entladen sich bei den untersuchten Fünfzehnjährigen durch auffälligen Drogenkonsum: Alkoholexzesse, Rauschgift. Sehr hoch gestiegen sind bei den Untersuchten Vandalismus und Diebstahl.
Alle diese Faktoren widerlegen die ständig gebetsmühlenartig vorgetragene Behauptung, dass Kinder allein durch möglichst frühes Einspannen ins Kollektiv einer Kinderkrippenbetreuung zu günstigem Sozialverhalten befähigt werden. Nach der amerikanischen Großstudie fördert die außerfamiliäre Betreuung bereits kleinster Kinder ohne ausgleichendes intensives erzieherisches und emotionales Bemühen der eigenen Eltern geradezu die Asozialität!
Ein Klischee lautet: Man müsse nur für eine ausreichend gute Qualität der Krippenbetreuung sorgen, dann sei alles in Ordnung, dann sei das Kindeswohl gewährleistet. Das ist ein Trugschluss, wie die Studien belegen: „Die Verhaltensauffälligkeiten waren weitgehend unabhängig von der Qualität der Betreuung. Kinder, die sehr gute Einrichtungen besuchten, verhielten sich fast ebenso auffällig wie Kinder, die in Einrichtungen minderer Qualität betreut wurden." Selbst qualitativ bester und höchster individueller Betreuungsaufwand ändert an der emotionalen Problematik nichts. Grundsätzlich bestätigt wird aber, dass das Erziehungsverhalten der Eltern einen deutlich stärkeren Einfluss auf die Entwicklung ausübt als die Betreuungseinrichtungen.
Also ist Erziehung ganz klar Elternsache, nicht an andere Instanzen abzutreten. Die an der amerikanischen Großstudie beteiligten Ärzte, Psychiater, Hirnforscher, Psychologen und Pädagogen empfehlen daher eindringlich: Die Eltern müssen in ihrem Erziehungsauftrag gestärkt werden. Die Betreuung in außerfamiliären Einrichtungen ist auf ein möglichst geringes Maß zu reduzieren. Böhm bedauert, dass diese Erkenntnisse hierzulande tabuisiert oder schlichtweg geleugnet werden. Die dringende Mahnung, die Betreuungsdauer zu verkürzen, wird politisch sogar geradezu ins Gegenteil verkehrt. Möglichst lange sollen immer mehr Kleinstkinder fernab von Mutter (und Vater) in entsprechende Einrichtungen abgegeben werden.
Die entsprechende Propaganda aber ist nicht nur bedenklich, sondern aufgrund der wissenschaftlichen Fakten grob fahrlässig, ja verantwortungslos - für die einzelnen betroffenen Kinder wie für die Zukunft unserer Gesellschaft. Denn das, was die Studie des amerikanischen Nationalinstituts feststellt, erweist sich, wie Rainer Böhm bestätigt, sogar nur als „Spitze des Eisbergs".
Untermauert werden die schwerwiegenden Bedenken durch inzwischen zahlreiche Untersuchungen des Stresshormons Cortisol. Davon kann man bei einem gesunden Biorhythmus einen hohen Wert am Morgen messen. Im Lauf des Tages flaut er jedoch bis zum Abend hin deutlich ab. Bei den ganztägig betreuten Kindern hingegen steigt die Ausschüttung dieses Hormons an. Das sei ein untrügliches Zeichen für dauerhaft hohe Stressbelastung. Fast alle Kinder zeigen diesen auffälligen Verlauf, selbst in Einrichtungen mit gehobener Betreuungsqualität. Selbst bei allerbester individueller Zuwendung in den Kitas stehen noch drei von vier Kindern am Abend unter „abnormem Stress", so Böhm. Diese Stressreaktionen lassen sich mit denen gehetzter Manager vergleichen. Chronischer Stress aber - und das bereits ab dem ersten Lebensjahr - macht nachweislich krank. Ähnliche chronische Stressbelastungen in jungem Alter weisen, wie die psychobiologische Forschung zeigt, ansonsten nur schwer misshandelte, sexuell missbrauchte und extrem vernachlässigte Kinder auf. Solche Stressprofile hat man zum Beispiel auch bei zweijährigen Kindern in rumänischen Waisenhäusern der neunziger Jahre gemessen, als schockierende Bilder von deren Leid durch die Weltpresse gingen. Für die an den Untersuchungen beteiligten Wissenschaftler ist klar: Eine große Zahl von Krippenkindern ist „durch die frühe und lang andauernde Trennung von ihren Eltern und die ungenügende Bewältigung der Gruppensituation emotional massiv überfordert".
Die dadurch verursachten Probleme verschärfen sich mit dem Jugendalter bis ins Erwachsenenalter. Speziell die neurologischen Zentren der Stressbewältigung werden geschädigt, denn die ersten Lebensjahre sind die wichtigsten und heikelsten für die Hirnentwicklung. Möglicherweise gräbt sich in dieser Phase der chronische Stress sogar in die genetischen Mechanismen ein, so dass die Regulationsstörungen an den eigenen Nachwuchs weitervererbt werden. Die Biologie spricht dabei von „epigenetischen" Phänomenen und Faktoren. Jedenfalls scheinen Krankheiten, die mit einem von Dauerstress geschwächten Immunsystem zusammenhängen, durch frühkindliche Erfahrungen begünstigt zu werden. Es gibt den Verdacht, dass die rasante Zunahme von Depressionen bereits bei jungen Leuten mit solchen Stressentwicklungen durch elterlichen Entzug zusammenhängt.
Böhm stellt fest, dass es vielen derzeit noch schwerfällt, die Forschungserkenntnisse anzunehmen - und dass politisch entsprechend viel falsch läuft. Selbst die Kinder- und Jugendmedizin in Deutschland habe erst in neuerer Zeit begonnen, sich dem Problemfeld eingehender zu stellen. Für Böhm gibt es nur eine Konsequenz: aufklären, aufklären und nochmals aufklären. Gleichzeitig kritisiert er scharf unter anderem die Bertelsmann-Stiftung, die mit hohem Aufwand die Krippenbetreuung propagiere und den Eltern weiszumachen versuche, dass ihr Kind durch möglichst frühe außerfamiliäre Förderung besonders schlau und klug werde. So sei „mit großem publizistischem Aufwand" eine hohe Rate von Gymnasialanmeldungen nach Krippenbetreuung plakatiert worden. Nach Böhm hat das allerdings ganz andere Gründe und ist auf den Ehrgeiz, den Stolz und die höheren Ansprüche einzig der Eltern zurückzuführen, die wollen, dass ihr Kind auf jeden Fall ein Gymnasium besucht. Mit einem „kognitiven Gewinn" durch womöglich ganztägige Versorgung in den Kinderkrippen habe das überhaupt nichts zu tun.
Die Wirtschaft will die Krippe
Rainer Böhm ist sich außerdem sicher: „Die deutsche ‚Krippenoffensive' geht wesentlich auf die massive politische Lobbyarbeit von Wirtschaftsverbänden zurück, die angesichts der demografischen Entwicklung versuchen, Arbeitskraftreserven auch unter jungen Eltern zu mobilisieren. So wird etwa in Publikationen wirtschaftsnaher Institute versucht, den Begriff ‚Familienfreundlichkeit' wesentlich über das Angebot an Krippenbetreuungsplätzen zu definieren. Die Bertelsmann-Stiftung, der operative Arm des großen europäischen Medienkonzerns, bereitet seit Jahren systematisch den Boden für eine langfristig geplante Expansion der Konzernaktivitäten ins lukrative und konjunkturunabhängige Bildungsgeschäft. Dabei wird auch die Meinungsführerschaft im Sektor frühkindliche Bildung angestrebt. Kritische Stimmen werden marginalisiert, andere dagegen in eigene ‚Studien' eingebunden, die die Konzernziele unterstützen. Auch die Betreuungsbranche macht sich für die Ausweitung des Krippenangebots stark, da sie sich von diesem Schritt Wachstumschancen erwartet, die durch staatliche Subventionierung abgesichert sind. Marktchancen winken auch Fachverlagen, die sich einen neuen Publikationssektor erschließen können. Universitäten und Fachschulen schließlich hoffen auf Steuergelder für neue Ausbildungsgänge." Und man muss - was Böhm nicht tut - in diesem Zusammenhang auch kritische Anfragen an die kirchlichen Sozialkonzerne Caritas und Diakonie richten, die ebenfalls intensivere Krippenbetreuung im Eigeninteresse fordern und fördern.
Die Leistung Erziehen
Für Böhm gibt es nur eine Alternative: mit der medizinischen Faktenlage mehr Nachdenklichkeit wecken. Vor allem ist die Erziehungsfähigkeit der Väter und Mütter zu stärken. Es sei unumgänglich, diesen bewusstzumachen, welche Bedeutung „ihre liebevolle und kontinuierliche Präsenz für die gesunde seelische Entwicklung ihrer Kinder gerade in den ersten Lebensjahren" hat. „Während Mütter durch Geburt und Stillzeit die Hauptbeziehungsperson der ersten Lebensphase sind, sollten Väter darin bestärkt und gefördert werden, diese Rolle häufiger im fortgeschrittenen Kleinkindalter zu übernehmen."
Die Politik aller Parteien - mitsamt der geschürten Krippenplatz-Hysterie - sieht der erfahrene Kinderarzt und Wissenschaftler auf einem falschen Weg, weil sie die Erziehungsleistung der Eltern gesellschaftlich faktisch weiter entwertet. Statt „Placebos" zu verteilen, müsste eine massive strukturelle Veränderung zugunsten eines echten Familienlastenausgleichs politisch in Gang gebracht werden. Dieser Ausgleich wäre zugleich eine Investition und Rücklage für die jüngeren Generationen, die eine durch massive Staatsverschuldung gefährdete Zukunft bewältigen müssen. Und das sind unsere Kinder und Kindeskinder.
Das Argument, dass allein Ganztagsfremdbetreuung von klein auf Kinder aus sozial schwierigsten Familien fördern kann, lässt Böhm derart allgemein ebenfalls nicht gelten. Natürlich müssen diese Betroffenen besondere Unterstützung und Zuwendung erfahren - aber eben gerade nicht außerhalb, sondern bevorzugt innerhalb der Herkunftsfamilien, im Rahmen ihrer ursprünglichen Lebenswelt, „in Anwesenheit ihrer primären Bindungspersonen". Dazu braucht man Familienhebammen, Elterntrainings, frühe heilpädagogische Maßnahmen, sozialpädagogische Hilfen etwa durch - wie man sie früher bezeichnete - Fürsorgehelferinnen. Notwendig seien ebenfalls stadtteilzentrierte Kleinkind-Spielgruppen, über die man die Mütter gezielt ansprechen kann, in einer gewissen „Freizone" außerhalb ihres engen prekären Umfeldes.
Das Kindeswohl ist nicht einfachhin identisch mit dem Elternwohl, mit den elterlichen Selbstverwirklichungsbedürfnissen. Elternsein stellt hohe Ansprüche - an jedes Paar. Elternpflicht ist nicht immer Elternlust. Aber Verantwortung meint zuerst Selbstverantwortung. Die intensive Eigenerziehung nimmt den Eltern niemand ab. Der freiheitliche Staat soll sie um seiner eigenen Zukunft willen durch Lastenausgleich unterstützen. Er darf die elterliche Bindung jedoch nicht ersetzen wollen. Das ist keine Erkenntnis der Ökonomie. Es ist eine Erkenntnis der Biologie - des Lebens selber. Vater, Mutter, Kind: Dem sollten wir uns wieder stellen, ideologiekritisch, kulturkritisch, politikkritisch.
CIG 19/2012
Wir freuen uns, wenn Sie CHRIST IN DER GEGENWART näher kennen lernen wollen. Die nächsten vier Ausgaben können Sie gleich hier kostenlos anfordern oder bei:
Verlag Herder, Kundenservice, D-79080 Freiburg
Fax 0761/2717-222, Telefon 0761/2717-200, E-Mail kundenservice@herder.de | |  |  |
|
 |
|  |  |  |  |
|
|  |